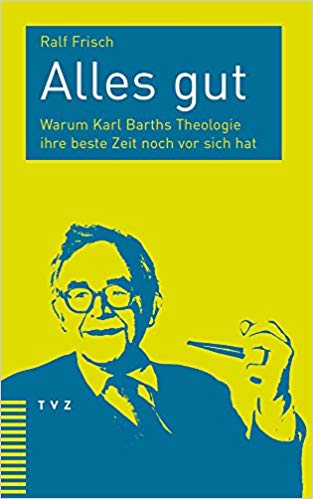Wie im letzten Jahr wollen wir zur Weihnachtszeit eine kleine Liste von Büchern bereitstellen, die wir, das NThK-Team sowie als Gäste Sabrina Hoppe und Philipp Greifenstein, jeweils selbst gerne gelesen haben und als Weihnachtsgeschenke, aber auch zur jahreszeitlich unabhängigen Lektüre empfehlen. In diesem Jahr ergeben sich aus den eingereichten Vorschlägen vier Kategorien: Zunächst die im engeren Sinne theologische Fachliteratur (I.). Unter der zusammenfassenden Überschrift „Frömmigkeit und kirchliches Leben“ (II.) finden sich Bücher, die zwar das Theologische berühren, aber doch einen anderen Fokus haben. In der Kategorie „Sonstiges“ (III.) wird ein Blick auf andere Wissenschaften – im engeren fachlichen wie popularwissenschaftlichen Sinne – geworfen. Schließlich gibt es am Ende eine eigene Rubrik für Belletristik (IV.). Die Auswahl der Bücher spiegelt persönliche Interessen und Vorlieben wider.
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre und eine besinnliche Adventszeit!
I. Theologische Fachliteratur
1) Johannes Fischer: Präsenz und Faktizität, Tübingen 2019.
Niklas Schleicher: In seiner neusten Aufsatzsammlung legt Fischer nochmal Beiträge zu zwei Themenbereichen vor, die ihn über die letzten zehn Jahre beschäftigt haben: Das Verhältnis von Ethik und Moral und die Frage der Bedeutung von Religion in der Ethik. Gerade zu letzterem Themenfeld sind die Überlegungen sehr weiterführend und in dieser Form von ihm noch nicht veröffentlicht. Seine Überlegungen sind gerade auch deshalb auch lesenswert, weil er eine einfache Übertragung von religiöser Lehre zu Handlungsanweisungen nicht nur hinterfragt, sondern einen gänzlich anderen Weg geht.
2) Wolfgang Huber: Bonhoeffer. Auf dem Weg zur Freiheit, München 2019.
Martin Böger: Ja, man könnte denken: Schon wieder ein Buch über Bonhoeffer. Aber ich finde Huber ist mit seiner Biographie Bonhoeffers etwas Besonderes geglückt. Auf relativ wenigen Seiten entwirft er nicht nur ein sehr persönliches und tiefgründiges Bild des Theologen und Widerstandskämpfers, sondern vermag es auch theologische Grundeinsichten und Fragestellungen zu beleuchten, die Bonhoeffer Zeit seines Lebens umgetrieben haben und auf die er weiterführende Antworten ausgeführt und angedacht hat. Was am Ende der Lektüre von Hubers Buch leider sehr schmerzlich deutlich werden kann, ist, dass die Ermordung Bonhoeffers durch das NS-Regime uns viel zu früh einen großen und wirkmächtigen Theologen genommen hat, der noch so manches hätte leisten können für Theologie, Gesellschaft und Kirche.
3) Jörg Hübner: Christoph Blumhardt. Prediger, Politiker, Pazifist. Eine Biographie, Leipzig 2019.
Julian Scharpf: Wer die Landeskirche Württemberg in ihrer Spannung zwischen individuell-spiritualisiertem Pietismus und weltumspannender sozialökologischer Reich-Gottes-Arbeit erkunden möchte, dem sei die Beschäftigung mit dem archetypischen Vater-Sohn-Gespann Blumhardt empfohlen. Zum 100. Todestag des Jüngeren, Christoph Blumhardt, legt der Direktor der Ev. Akademie Bad Boll, Jörg Hübner, eine Biographie vor, die sich auf neu zugängliches Archivmaterial beziehen kann. Diese Biographie lässt die Leser*innen das Denken und Wirken des „bibel- und auch Bebelfesten“ Blumhardts schlüssig nachvollziehen.
Gerade in der Zusammenschau mit den unterschiedlich akzentuierten Vor- und Nachworten ergibt sich das Bild eines Menschen, dessen Impulse in Fragen der Gerechtigkeit, Ökologie und des Friedens auch in unserer Zeit beachtenswert sind. Neben dieser Lektüre empfiehlt sich immer auch ein Spaziergang durch Bad Boll, um sich in der Ev. Akademie, dem Literatursalon der Villa Vopelius, auf dem Friedhof und im Kurhaus in den Bann der Blumhardts ziehen zu lassen.
4) Karin Oehlmann: Glaube und Gegenwart. Die Entwicklung der kirchenpolitischen Netzwerke in Württemberg um 1968 (Arbeiten zur Kirchlichen Zeitgeschichte, Bd. 62), Göttingen 2016.
Martin Böger: Ich gebe gleich zu: Ja vielleicht ein Buch für Insider und Liebhaber des württembergischen kirchenpolitischen Sonderwegs. Aber auch für alle anderen interessant, die sich für die Entwicklung des Protestantismus in der frühen Bundesrepublik interessieren. Oehlmann kann nämlich sehr deutlich machen, wie gesellschaftspolitische Themen kirchliche Kreise bewegen und zu einer innerkirchlichen Politisierung führen. So zeigt sie, dass einerseits der Bultmann-Streit um die historisch-kritische Methode zumindest in Württemberg zu großen Zerwürfnissen geführt hat und andererseits das beginnende Kirchentagsengagement im Fahrwasser der 1968-Bewegung innerkirchlich weite Kreise gezogen hat, die bis heute Wirken. Beides bewegt also die Kirche und ihre Diskussionen: Theologische Sachfragen und gesellschaftliche Entwicklungen. Und das ist auch gut so!
5) Sonja Angelika Strube (Hg.): Rechtsextremismus als Herausforderung für die Theologie, Freiburg i. Br. 2015.
Philipp Greifenstein: Nicht nur in der Sächsischen Landeskirche begeben sich Christ*innen auf die Reise herauszufinden, was noch „wertkonservativ“ und was schon rechtsradikal ist. Neben dem Grundlagenwerk „Rechtsextremismus“ von Samuel Salzborn sind die von Sonja Angelika Strube herausgegebenen theologischen Sammelbände („Das Fremde akzeptieren“, Freiburg i. Br. 2017) dafür eine unverzichtbare Wegbegleitung. Denn es ist ja überhaupt nicht so, dass auf dem Feld der Auseinandersetzung von Kirche und Theologie mit rechtsradikalem Gedankengut nicht schon geackert würde.
Dabei eignet sich der erste Band „Rechtsextremismus als Herausforderung für die Theologie“ auch als Einstieg für Theolog*innen und Kirchenmitarbeiter*innen, die bisher der Thematik keine Aufmerksamkeit gewidmet haben. Autor*innen unterschiedlicher Hintergründe beschreiben Erscheinungsformen rechten Denkens in Theologie und Kirche und buchstabieren durch, welche Ideologien der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit besondere Relevanz für den christlichen Kontext haben. Was ich schon 2015 geschrieben habe, gilt auch jetzt: „Dieses Buch gehört in diesem Jahr auf jeden Schreibtisch, hinter dem ein theologisch interessierter Mensch sitzt.“
6) Christiane Tietz: Karl Barth. Ein Leben im Widerspruch, München 2018.
Tobias Jammerthal: Zu den Erträgen des Karl-Barth-Jahres gehört auch diese Biographie, die tatsächlich eine Biographie sein will – anders als andere Bücher über den großen Basler, die Biographie und Roman mischten. Die maßgebliche Darstellung von Barths Lebenslauf wurde von seinem persönlichen Assistenten Eberhard Busch verfasst; entsprechend groß sind die Fußtapfen, in die Christiane Tietz tritt. Aber schnell merkt der Leser: Hier hat sich jemand nochmal durch die Quellen durchgearbeitet. Die Zürcher Ordinaria folgt den Spuren des Materials, kontextualisiert es im erforderlichen Rahmen, gruppiert es thematisch und chronologisch und schreibt bei alledem gut lesbar. Ihren Respekt vor Barth will Tietz nicht verbergen, lässt sich dadurch aber nicht dazu verleiten, unkomfortablen Zusammenhängen aus dem Weg zu gehen (vgl. die etwa 20 Seiten zur Dreiecksbeziehung zwischen Barth, seiner Gattin und Charlotte von Kirschbaum). Man liest es gerne und lernt dabei.
II. Frömmigkeit und kirchliches Leben
1) Susanne Breit-Kessler/Susanne Janssen: Die großen Töchter Gottes. Starke Frauen der Bibel, Leipzig/Stuttgart 2018.
Claudia Kühner-Graßmann: Von den nicht wenigen Büchern, die es zu Frauen in der Bibel gibt, spricht mich dieses von der Deutschen Bibelgesellschaft und edition chrismon herausgegebene Buch besonders an. Die Porträts von Malerin Susanne Janssen und die Texte von Susanne Breit-Kessler schaffen zusammen einen berührenden ästhetischen Zugang zu verschiedenen Frauen der Bibel. Mit und aus dem konkreten biblischen Kontext werden Porträts in Bild und Text geschaffen, die zugleich allgemein Menschliches, ja „Weibliches“ beinhalten. Es ist keine Verklärung weiblicher Stärke, sondern gerade die Spannung von Mut und Vorsicht, Erfolg und Scheitern: So hält Breit-Kessler für Mirjam durchaus ambivalent fest: „Gottes kleine und große Töchter haben gelegentlich einen hinreißenden rebellischen Schwung, der sie ab und zu weit über die Ziellinie hinausträgt.“ Pragmatisch geht es aber weiter: „Das ist so. Dann gilt es innezuhalten, nachzudenken, sich zu besinnen und schließlich, klüger geworden, weiterzumachen“ (S. 22). Die biblischen Frauengestalten werden so zu Vorbildern für die Gegenwart. Die wortgewaltigen, anregenden, behutsamen Texte nehmen mit hinein in die Situation der sechs Frauen aus dem Alten und sechs aus dem Neuen Testament und bringen die eindrücklichen Bilder zum Leben. Das Buch ist für nicht nur eine Geschenkidee für „Töchter Gottes“, sondern stellt auch einen künstlerischen Zugang zur Predigtvorbereitung bereit, der zugleich theologisch wie biblisch fundiert ist.
2) Susanne Niemeyer, Siehst Du mich? Das andere Jugendgebetbuch, Freiburg i. Br. 2017.
Sabrina Hoppe: Wer die Geschichten, Gedankenstreusel und Postkarten von Susanne Niemeyer kennt, weiß, dass sie auf eine Art und Weise Fragen stellen kann, die einen eine Antwort finden lassen, ohne dass man es selbst merkt. Vielleicht ist es auch anders herum: Sie gibt Antworten, die im eigenen Kopf zu Fragen werden. Man kann ihre Bücher an Menschen verschenken, die ehrenamtlich in der Kirche arbeiten, man kann ihre Impulse zu Predigten verarbeiten oder ihre Postkarten zur Konfirmation verschenken.
Niemeyers Gedanken und Bilder zwischen Fragen, Antworten, Himmelreich und Pistazieneis passen aber tatsächlich auch besonders gut zu einer ganz anderen Zielgruppe: zu Jugendlichen in Schule und Konfirmationsunterricht. Gemeinsam mit ihrer Schwester Friederike Niemeyer hat sie 2017 mit „Siehst Du mich?“ ein kleines „Jugendgebetbuch“ herausgegeben, das weder Lernstoff noch Jugendkatechismus ist, sondern zum Selberdenken, Schreiben, Malen und Nachfragen bringt: „Es gibt tausend Wege, Gott zu finden. Finde deinen“, ist der rote Faden des Buches. Theologisch ausgedrückt wählt sie einen anthropologischen Zugang, um Jugendliche nach ihren Bildern von Gott und der Welt zu fragen. Pädagogisch formuliert liefert sie Denkanstöße für das eigene Nachdenken. Und ganz subjektiv: Sie schreibt in wunderschönen, knappen Sätzen auf, was es heißt, Gott zu suchen: Wer bin ich und wo suche ich deshalb nach Gott? Wo beginnt der Himmel und wer kann ihn aufhalten? Was trägt Dich? Kann man sich selbst erlösen?
Sie stellt diese Fragen in Dialogen, lässt Platz frei für Zeichnungen, stellt Linien für eigene Worte und Formulierungen zur Verfügung, schreibt To Do Listen auf, die nicht unter Druck setzen, sondern befreien könnten und wirft immer wieder kurze Gebete dazwischen. Klar, auf 74 Seiten ist wenig Platz für theologische Grundsatzdiskussionen noch ausgewogene Überlegungen zum Kreuzestod. Aber das Kreuz, die Schuld, die verlorene Freiheit werden nicht ausgeklammert – sie bekommen andere Worte und Bilder, Fragezeichen und Sätze, die von der eigenen Hoffnung erzählen, an die Seite gestellt. Dadurch nimmt Niemeyer junge Menschen ernst, ohne sie heillos zu überfordern und vermittelt ihnen vor allem, dass Theologie nicht darin besteht, Antworten zu geben, sondern sich zu trauen, Fragen zu stellen. Wenn das dem eigenen Horizont von Gemeinde-und Religionspädagogik entspricht, dann kann ihr Buch entweder als Begleiter in der Konfirmationsarbeit oder einfach seitenweise als Arbeitsblattersatz bei Jugendkreisen, im Religionsunterricht oder bei Jugendgottesdiensten eingesetzt werden.
„Fass Dir ein Herz, lerne Träume zu deuten. Schau hinter die Dinge, führ die Hoffnung spazieren. Dann sehen wir weiter.“ – Wer das nicht kitschig findet, sondern klug, der könnte mit diesem Buch sehr froh werden!
III. Sonstiges
1) Max Czollek: Desintegriert Euch!, München 2018.
Philipp Greifenstein: Die schönste und lehrreichste meiner Sommerurlaubslektüren in diesem Jahr: Der Lyriker und Essayist Max Czollek schreibt über das spannungsgeladene Verhältnis der Deutschen zu den deutschen Juden. Und er greift in seinem bereits im letzten Jahr erschienenen Buch die Mär von der Integration an. „Desintegriert Euch!“ ist ein Erklärbuch für unsere Gesellschaft. Es lässt sich daraus für den Blick auf unterschiedliche Minderheiten lernen. Die Leser*in wird feststellen, dass unsere Gesellschaft aus vielen marginalisierten Gruppen besteht, für die – in weniger drastischer Weise – gilt, was Czollek für die Juden in Deutschland beschreibt.
Für Theolog*innen ist es deshalb besonders interessant, weil die jahrhundertelange Unterdrückung der europäischen Juden und der Anpassungsdruck der Mehrheitsgesellschaft heute ohne die christliche Tradition gar nicht erklärbar sind. Dazu tragen auch theologische Überzeugungen bei, die Jüdinnen und Juden systematisch gegenüber Christ*innen abwerten, ihre heiligen Schriften okkupieren und – in ihrer liberal-deutschen Form – nicht davor zurückschrecken, jüdische Erfahrung und Geschichte in die christliche einzugemeinden. Genau gegen solche Übergriffigkeiten wehrt sich Czollek.
2) Thomas Ebermann: Linke Heimatliebe. Eine Entwurzelung (Konkret Texte), Hamburg 2019.
Niklas Schleicher: Protestantismus hat auch immer was mit Kritik an überkommenen Götzen und Ideologien zu tun. „Heimat“ ist, gerade auch zu Weihnachten, eine solche Ideologie und wird in den letzten Jahren auch immer mehr von links verteidigt und besetzt. Dieses Buch zieht dagegen ins Feld und schafft es anhand von ausgewählten Beispielen „linke Heimatliebe“ zu dekonstruieren. Kein Buch für gute Laune, aber auch solche Bücher haben ja unter dem Weihnachtsbaum ihren Platz.
3) Cathrin Misselhorn: Grundfragen der Maschinenethik, Stuttgart 2018.
Niklas Schleicher: Zum Thema KI und autonome Systeme wird, gerade auch in kirchlichen Medien, viel geschrieben. Und vieles vom Geschriebenen ist, sagen wir mal, von eher diskussionswürdiger Qualität. Um einen halbwegs ordentlichen Stand zu bekommen, gerade was die ethischen Fragen im Zusammenhang mit diesen Themen angeht, empfiehlt sich das Buch der mittlerweile nach Göttingen berufenen Philosophin Cathrin Misselhorn. Das Buch ist, soweit das für das Thema überhaupt möglich ist, auf aktuellem Stand, führt kundig in die wichtigsten Themen ein und diskutiert die Fragen anhand von aktuellen Beispielen.
4) Chantal Mouffe: Agonistik. Die Welt politisch denken, Berlin 2014.
Tobias Graßmann: Chantal Mouffes Buch sammelt Essays, die ihre agonistische Theorie des Politischen auf verschiedene Fragestellungen anwenden – mit dem Ziel, die Denkfehler des technokratischen Liberalismus ebenso zu korrigieren wie die Selbsttäuschungen linker Politik. Das Politische, so die Grundannahme, bearbeitet einen nicht-auflösbaren Antagonismus. Der Kampf um die Macht, die Vorläufigkeit jeder Machtkonstellation und die Spaltung der Gesellschaft müssen voll anerkannt werden, um ein angemessenes Verständnis des Politischen zu gewinnen. Ließen sich die letzten Gegensätze in der Gesellschaft nicht durch moralische Appelle, einen umfassenden Interessenausgleich oder eine objektive Vernunft aufheben, könne die Gegnerschaft doch in eine agonistische Form von Politik transformiert und so entschärft werden. Besonderes Augenmerk legt Mouffe dabei auf die Funktion von Kollektividentitäten und politischen Leidenschaften. In ihrem Essayband finden sich Überlegungen zur multipolaren Welt, zur Zukunft der EU, zum Verhältnis linker Politik zu politischen Institutionen sowie zur politischen Funktion der Kunst. Die Lektüre stimmt angesichts des gegenwärtigen Zustands linker Diskurse etwas wehmütig, aber bietet zahlreiche Anregungen für das Verständnis der politischen Entwicklungen auf nationaler wie internationaler Ebene.
5) Annemarie Pieper: Einführung in die Ethik, 7. Auflage, Tübingen 2017.
Niklas Schleicher: Das Buch ist ein ziemlicher Klassiker, was die Einführung in die Ethik angeht. Es handelt sich hierbei um eine Überblicksdarstellung der philosophischen Ethik und ihrer Teilthemen. Da es sehr komprimiert ist, scheint es nicht die beste Lektüre für die Erstbegegnung mit Ethik zu sein. Aber: Gerade zur Wiederauffrischung Richtung Prüfungen oder Examen kann es sehr gute Dienste leisten, zumal es wirklich schön und einfach geschrieben und durch gutes Layout auch sehr nutzerfreundlich gegliedert ist.
6) Matthias Quent: Deutschland rechts außen, München 2019.
Philipp Greifenstein: Für mich ist Matthias Quents Durchgang durch den aktuellen Rechtsradikalismus das Sachbuch des Jahres. Es besticht durch Fachkenntnis und einen grundlegend anderen Zugang zum Thema: Quent schreibt zugleich als Wissenschaftler und als Betroffener rechtsradikaler Angriffe. Unter dem Schlagwort „Baseballschlägerjahre“ wurde im Herbst über Gewaltangriffe von Rechts diskutiert. Im Anschluss an den Anschlag in Halle wurde auch daran erinnert, dass der gewaltbereite Rechtsradikalismus in Deutschland eine traurige Tradition hat. Wer Geschichte und aktuelle Situation des Themas verstehen will, der greife zu diesem Buch.
IV. Belletristik
1) Alan Bradley: Flavia de Luce Mysteries, New York 2009ff.
Tobias Jammerthal: Krimis lesen gehört angeblich zu den üblichen Lastern der Theologenschar – auch ich gehöre zu denen, die abends oder in den Ferien gerne mal zu einem solchen greifen. Freilich: auch hier gibt es Konfessionen zwischen den Anhängern des klassischen englischen Kriminalromans und den Freunden der skandinavischen Ermittler. Alan Bradleys Krimireihe, beginnend mit „The Sweetness at the Bottom of the Pie” (deutsch: Mord im Gurkenbeet), gehört sowohl vom Erzählstil wie vom Setting in erstere Kategorie. Die Hauptfigur ist ein elfjähriges Mädchen, dessen Neugierde in allererster Linie der Chemie gilt, die aber auf dem Familiensitz Buckshaw zur veritablen Ermittlerin avanciert. Vor dem Panorama der englischen 1950er Jahre stößt das neunmalkluge Kind auf Rätsel und Verbrechen, die es, manchmal mit mehr Glück als Verstand, löst, und sich nebenbei einen Kleinkrieg mit ihrer pubertierenden größeren Schwester liefert. Bradley schreibt seine Krimis aus der Perspektive des Mädchens, was den Leser immer wieder schmunzeln lässt – die perfekte Lektüre für die ruhige Zeit zwischen den Jahren!
2) Klaas Huizing: Zu Dritt. Karl Barth, Nelly Barth, Charlotte von Kirschbaum. Roman, Tübingen 2018.
Claudia Kühner-Graßmann: Anfang des Jahres habe ich dieses Buch ausführlich besprochen.[1] Jetzt, zu Endes des Karl-Barth-Jahres und für die gemütliche kalte Zeit zwischen den Jahren, möchte ich es nochmals aufgreifen und empfehlen. Klaas Huizing thematisiert in seinem Roman die Dreiecksbeziehung zwischen Karl Barth, Nelly Barth und Charlotte von Kirschbaum. In einer eigentümliche Mischung aus Historie, Romandarstellung, Fiktion und theologischer Werkerschließung geht Huizing diesem privaten, fast schon delikaten Teil der Biographie Karl Barths nach, ohne einem platten Voyeurismus zu verfallen. Genau das richtige Buch, wenn man sich nicht ganz von der Theologie lösen kann und dennoch mal etwas anderes lesen will. Aber man sollte sich dabei immer vor Augen halten, dass es sich um einen Roman und nicht um eine Biographie handelt!
3) Andrej Platonow: Die Baugrube. Neuübersetzung von Gabriele Leupold, Frankfurt a.M. 2016.
Tobias Graßmann: Andrej Platonows avantgardistischer Roman Die Baugrube spielt im Nirgendwo der frühen Sowjetunion. Es ist die Geschichte eines sowjetischen Turmbaus zu Babel, erzählt im Sprachgewirr einer zu Parolen erstarrten oder verstümmelten Sprache. Die Protagonisten – Arbeiter, Bauern, Veteranen, Parteifunktionäre – träumen den Himmel auf Erden und ein ewiges Heim für die versöhnten Volksmassen. Aber sie schaufeln nur ein immer tieferes Loch in die Welt. Den „Neuen Menschen“ vor Augen, stürzen sie zurück in die Tierhaftigkeit, so dass ein vom Schmiedefeuer versengter Bär zwischen ihnen gar nicht weiter auffällt – und folgerichtig seinen Teil zur Liquidierung der reaktionären Bauernschaft beitragen darf. Platonow enthält sich der Moralisierung wie der psychologischen Deutung und überlässt den von korrumpierter Sprache entstellten Gedanken der handelnden Personen das Wort. Der Roman streift das Groteske, ohne das Unbehagen am allzu Wirklichen ins Phantastische aufzulösen. So entzieht sich dieses Buch einer einfachen Vereinnahmung und regt zum Denken über Gemeinschaft und Einsamkeit, Vergänglichkeit und Ewigkeit, menschliche Hybris und die Unbarmherzigkeit der Natur an. Die Leistung der Übersetzerin angesichts dieses virtuosen Umgangs mit Sprache kann der Laie nur erahnen!
4) Marieke Lucas Rijneveld: Was man sät, Berlin 2019.
Julian Scharpf: Ein zehnjähriges Mädchen wächst in einer strenggläubigen calvinistischen Familie auf einem Bauernhof in Holland auf. Als es vor Weihnachten befürchtet, dass sein Kaninchen geschlachtet wird, bittet es Gott darum, dass er lieber den Bruder Matthies zu sich nehmen soll. So kommt es dann auch, Matthies ertrinkt beim Schlittschuhlaufen. Die Tochter ist aber nicht die Einzige in ihrer Familie, die die Schuld für diese als Strafe Gottes empfundene Katastrophe in ihren vermeintlichen Verfehlungen sucht.
Von der ersten Seite an zieht dieses Buch in den Bann und stößt ab; es löst Mitgefühl und Ekel aus. Hier werden Abgründe ausgelotet, Vieles ist verstörend und nur schwer zu ertragen. Die Atmosphäre der beklemmenden Dunkelheit erinnert an Filme wie „Das weiße Band“ von Michael Haneke oder auch Lars von Triers „Breaking the Waves“, die beide ebenso in protestantisch geprägten Dorf- und Familienstrukturen spielen. Man spürt dem Buch ab, dass Marieke Lucas Rijneveld die Verhältnisse sehr genau kennt, die sie beschreibt. Manche Bibelworte lassen sich nicht mehr schmerzfrei zitieren, wenn man ihre autoritäre Instrumentalisierung in diesem Roman erlebt hat. Ein Schlag in die religiöse Magengrube. Dieses Buch eignet sich nicht als Weihnachtsgeschenk für die Schwiegereltern, man sollte es selbst lesen.
[1]https://netzwerktheologie.wordpress.com/2019/01/30/klaas-huizings-zu-dritt-ein-leseeindruck/