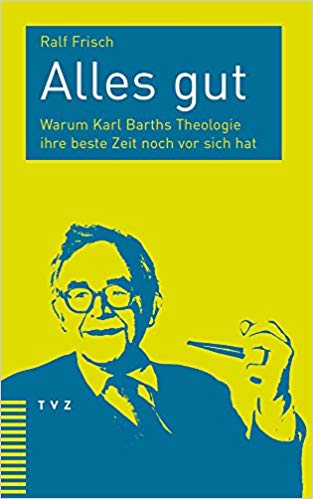Rezension zu: Ralf Frisch, Alles gut. Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat, Zürich 2018
von Niklas Schleicher (@megadakka)
Das Barth-Jubiläum bringt es mit sich, dass unzählige Publikationen zu Ehren oder zur Erinnerung des großen Theologen erscheinen. Es gibt Romane, Biographien, Sammelbände, Studien zu seiner Theologie, aber auch eigenwilligere Entwürfe. Zu letzteren zählt sicherlich auch das Buch „Alles gut“ des Nürnberger Professors für Systematische Theologie Ralf Frisch.
Der Untertitel lautet „Warum Karl Barths Theologie ihre beste Zeit noch vor sich hat“. Der Autor unternimmt dabei den Versuch einer Re-Lektüre der barth‘schen Theologie (vor allem der KD), indem er eine andere Perspektive auf das Werk Barths einnimmt. Dazu später mehr.
Die knapp 200 Seiten des Buches sind gut geschrieben; das Buch liest sich angenehm, sieht man von manchen Wiederholungen und Redundanzen ab. Der Stil der 12 Kapitel ist dabei durchaus so, dass auch Nicht-Theologen* wahrscheinlich einige Dinge mit Gewinn lesen werden können. Stilistisch sind einige Metaphern anzumerken, die, um es diplomatisch auszudrücken, etwas schräg sind, so zum Beispiel, wenn vom „theologischen Absaugmanöver“ (93) die Rede ist.
Man kann das Buch in gewisser Weise in zwei unterschiedliche Ebenen unterteilen, die freilich ineinander verzahnt sind.
Die erste Ebene ist dabei eine Rekonstruktion der Theologie Karl Barths, die mit Barths theologischem Neuansatz im Römerbriefkommentar beginnt, dann aber vor allem die Theologie der Kirchlichen Dogmatik darstellt und rekonstruiert. Dabei behandelt er die Themen weniger chronologisch, als vielmehr thematisch und beschreibt Barths Gotteslehre, seine Anthropologie, die Ethik, die Ekklesiologie und die Versöhnungslehre. Insgesamt gelingt Frisch hierbei eine recht gelungene Rekonstruktion, die freilich nicht viel Neues bringt, und mehr oder weniger Mainstream der Barth-Forschung darstellt, nicht zuletzt auch aufgrund der immer wieder eingestreuten Spitzen gegenüber liberaler Theologie, so zum Beispiel:
„[Barths frühe Theologie ist] starker Tobak und keine geringe Zumutung für eine theologische Zeit, die von vielen Repräsentanten der liberalen Theologie leichtere Kost gewohnt war“ (59).
Hier ist freilich zu fragen: Welche liberale Theologie hat Frisch vor Augen und was ist leichtere Kost? Besser in den Zeitgeist der Avantgarde passte doch sicherlich Barths am Expressionismus geschulte theologische Sprache.
Und dann natürlich das inhaltliche Problem, das sich darin zeigt, dass Frisch nie genau deutlich macht, ob eher der Gott in den Vordergrund gestellt werden soll, der „regiert“ oder derjenige, der sich unendlicher Verschiedenheit zur Welt befindet, und zu dem auch die Menschen eigentlich keinen Weg haben und finden sollen. Freilich, dieser religionskritische und gleichzeitig christuszentrierte Blick des Christentums ist so etwas wie die DNA eines Barthianers, aber man sollte halt nicht vergessen, welche Probleme man sich auflädt, gerade auch auf ekklesiologischer Ebene. Die aktuelle kirchliche Öffentlichkeit kommt dann bei Frisch auch nicht besonders gut weg und wird, auch das ist ja mittlerweile einheitsstiftendens Moment vieler theologischen Richtungen, für Dinge wie ökologisches Bewusstsein kritisiert (108).
Aber gut, insgesamt kann man das alles als gute, süffige Einführung in eine Art des Barthianismus lesen. Man wird davon nicht dümmer und kann den einen oder anderen nützlichen Gedanken mitnehmen.
Die zweite Ebene des Buches ist dann die eigentliche Neuerung und dass es innovativ sei, wie Frisch Barth liest, nun, das betont Frisch selbst des Öfteren. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, selbst, wenn man diese sich selbst zusprechen muss. Das neue und innovative ist, dass Barths Theologie als Erzählung gekennzeichnet wird. Barth wird verglichen mit J.R.R. Tolkien, die KD wird mit „Herr der Ringe“ parallelisiert. Die Ausgangsthese ist nämlich, dass Barths Theologie zu ungewöhnlich, zu groß ist, als dass sie sich einfach dem Geschäft wissenschaftlicher Plausibilisierung unterwerfen könnte. So werden der theologischen Rekonstruktion quasi fundamentaltheologische Prolegomena vorausgeschoben. Doch was in klassischen Entwürfen Abhandlungen über das Verhältnis von Bibel und Bekenntnis, über die Bedeutung der Vernunft oder der natürlichen Gotteserkenntnis waren, sind hier eben die Einordnung der barth‘schen Theologie als Fiktion und ihr Vergleich mit anderen romanhaften Werken (29-73).
Diese Idee scheint wirklich interessant zu sein, nimmt sie doch recht gut einen Trend in den Geisteswissenschaften auf, der sich irgendwie unter den Begriffen Narrativität und Narratologie verorten lässt. Und der Vergleich mit Tolkien ordnet Barths Theologie auch wirkungsgeschichtlich dort hin, wo sie zu Hause ist: Beides sind epochenmachende Werke von ungeheurer Detailtiefe und Wirkung.
Soweit, so gut? Nun ja. Meiner bescheidenen Meinung nach nimmt Frisch für seine spritzige Idee Probleme in Kauf, die sowohl Barth, der Aktualisierung seiner Theologie als auch der theologischen Wissenschaft einen Bärendienst erweisen.
Denn was passiert, wenn theologische Werke als Fiktionen eingeordnet werden? Sie entziehen sich zunächst der Überprüfbarkeit durch theologische Forschung. Denn: Kriterien der Wissenschaftlichkeit lassen sich eben kaum auf Tolkien anwenden, einziges Kriterium ist innere Stimmigkeit. Freilich, Barths Theologie hatte immer eine eigenständige Stellung gegenüber anderen Wissenschaften zu behaupten versucht, aber er konnte wenigstens Kriterien benennen, denen seine Theologie entsprechen muss, und seien es nur eine Übereinstimmung mit der biblischen Offenbarung.
Dieses Problem liegt auch daran, dass Frisch nicht die Heilsgeschichte oder das Christusereignis als Fiktion verstehen will, sondern die theologische Reflexion Karl Barths darüber. Um das etwas klarer zu machen: In der Theologie spielen Narrationen zum Beispiel eine Rolle, wenn es darum geht zu überlegen, wie eigentlich moralische Orientierung funktioniert. So Johannes Fischer. Er arbeitet heraus, dass unser moralisches Verstehen, also das Einordnen einer Situation als ethisch relevant und unsere daraus ergebende Handlungen durch Erzählungen geprägt sind: „Grausam“ verstehen wir, wenn jemand eine Situation schildert die grausam ist. Ja, selbst unsere Lebensführung als ganzes und damit unsere ethische Orientierung ist symbolisch verfasst und damit auch auf Narrationen angewiesen. Aber: Das Geschäft des Ethikers ist es nicht, die eigene Reflexion darüber als Erzählung zu verfassen, die reflexive Ebene ist bei diesem Fall deskriptiv und kritisch: Sie stellt die Narrationen in einen Kontext und versucht die Bedingungen und ihre Geltung zu beschreiben.
Und weiter: Karl Barth würde wahrscheinlich der Einordnung seiner Theologie nicht nur nicht zustimmen, ich denke, er würde sie ablehnen. Nicht nur, weil seine Theologie zwar sprachlich interessant ist, aber doch nicht den ästhetischen Kriterien eines Romans entspricht. Die Gegenprobe lässt sich recht einfach machen: „Herr der Ringe“ wurde deshalb wieder zu einem echten Bestseller, weil die Bücher brillant verfilmt wurden. Ich jedenfalls mag mir keine Verfilmung der KD vorstellen (außer Robert Downey Jr. spielt die erste Person der Trinität).
Aber weg von Spekulationen über das, was Barth denken würde – auch davon ist Frischs Buch selbst nicht frei – hin zu dem, was Sache ist: Barth war es um seine Theologie ernst. Ihm ging es um was. Am „Nein“ gegen Brunner ist nichts Verspieltes oder Lustiges. Und auch wenn sich seine Theologiegeschichte teilweise vergnüglich liest, ist ihm die Ablehnung des 19. Jahrhunderts doch sehr ernst.
Und weiter: Barths Theologie war immer geprägt durch Zeitgenossenschaft in einem ganz spezifischen Sinne. Als Pfarrer in der Schweiz sah er die Armut der Arbeiterschaft und entwickelte Sympathien für den religiösen Sozialismus. Dann sah er im ersten Weltkrieg und danach die Fehler des Kulturprotestantismus und entwarf eine Theologie, die Gott als den anderen, den richtenden Gott in den Vordergrund stellte. Im dritten Reich und danach stellte er die Macht Gottes gegen die Herrscher der Welt. Und freilich: Barth hat selbst etwas Gelassenes an sich. Aber seine Gelassenheit ist doch darin begründet, dass es um seine Theologie umso ernster ist. Das Gott regiert ist keine schöne Gegenerzählung und nichts, dass sich mit Frodos Weg zum Schicksalsberg oder Gimlis Heldenmut bei Helms Klamm vergleichen lässt. Dass Gott regiert, muss für Barth wahr sein, ansonsten ist alles verloren. Es war für ihn nicht „Alles gut“ in dem Sinne, dass Theologie doch nichts anderes ist als ein großes Spiel, dass entweder sich auszahlen könnte oder auch nicht.
Was Frisch also treibt, ist eine Pascal’sche Wette höherer Ordnung, nur dass er sich als Gewährsmann den größten Theologen des 20. Jahrhunderts nimmt, der sich halt nicht mehr so recht wehren kann. Ich bin wirklich kein Barthianer, und Frischs Werk hat unter diesen und auch anderen durchaus viel Zustimmung und Interesse erhalten. Es könnte mir eigentlich reichlich egal sein, wer Barth wie interpretiert und anwendet. Aber was man von Barth lernen kann: in der Theologie kann es um alles gehen. Denn, und das zum Schluss: Eine „fiktionale Gegenerzählung“ hat eben ein entscheidendes Merkmal: Sie ist fiktiv. Und sollte es das sein, was die Theologie über Gott zu sagen hat, dann können wir es halt auch bleiben lassen.